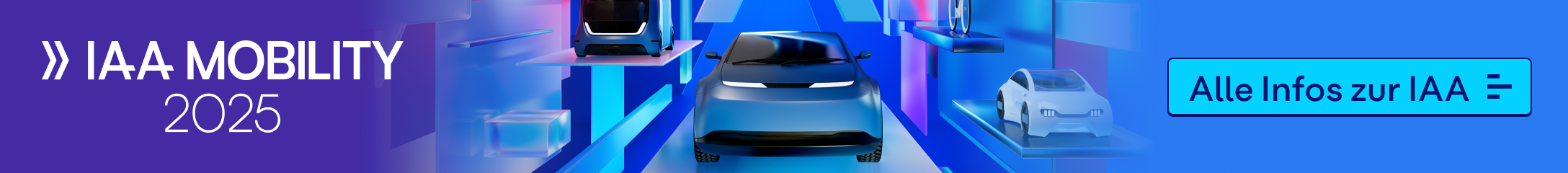Die Bundesregierung will Glasfaser bis in jedes Haus bringen. Zwar ist das Ziel 2030 von der neuen Bundesregierung inzwischen beerdigt, der generelle Plan aber bleibt – ohne Zeithorizont. Das Ziel ist ambitioniert, der Fortschritt bleibt jedoch hinter den Erwartungen zurück. Ein zentraler Bremsklotz: die Netzebene 4 – also die Verkabelung innerhalb von Mehrfamilienhäusern. Während der Glasfaserausbau in ländlichen Regionen teils beachtlich voranschreitet, stockt er in den Städten. Der Grund: Die Wohnungswirtschaft zeigt wenig Interesse, ihre Bestände auf den neusten Stand zu bringen. Henrik Bremer, Wirtschaftsprüfer und Telekommunikationsexperte, bringt es auf den Punkt: „Warum soll die Wohnungswirtschaft investieren, wenn sie es nicht muss?“ Gerade in Ballungsräumen, wo die Nachfrage nach Mietwohnungen ungebrochen hoch ist, sehen viele Eigentümer schlicht keinen Druck, ihre Immobilien digital aufzurüsten, sagte der Fachanwalt auf dem Breitbandkongress des Branchenverbandes FRK in Leipzig.
Kabelnetze reichen für die meisten Mieter aus
Zudem funktioniere die bestehende Technik in vielen Fällen noch gut. Kabelnetze liefern zwar kein echtes Glasfaser-Internet, bieten aber aus Sicht der meisten Mieter ausreichend Geschwindigkeit. Der Unterschied zur Glasfaser ist für viele im Alltag kaum spürbar. Solange keine spürbaren Vorteile wie günstigere Tarife, stabilere Verbindungen oder neue Dienste entstehen, bleibt der Anreiz zur Umrüstung gering.
Doch genau das wird zum Problem: Denn ohne Modernisierung der Netzebene 4, also der Leitung vom Keller bis in deine Wohnung, bleibt die Glasfaser sprichwörtlich vor der Tür. Weder Open Access noch Anbieterwechsel funktionieren, wenn die Verkabelung im Haus fehlt oder nur exklusiv durch einzelne Betreiber genutzt werden kann. Das nächste Problem: Mit einer solchen nicht zu Ende gebauten Leitung verdient niemand Geld. Der Glasfaseranbieter hat aber bereits mehrere tausend Euro investiert, um die Leitung zumindest bis vor die Haustür zu bringen. Dass nun niemand diese Leitung bucht, schmerzt die Investoren.
Bremer spricht von einem „evidenten Marktversagen“: Die Investoren kämen nicht, weil sich der Ausbau wirtschaftlich kaum lohnt. „Wer heute Glasfaser bis zur Wohnung bringt, handelt aus Überzeugung oder weil er die Monopolstellung fürchtet.“ Ein funktionierendes Geschäftsmodell sehe anders aus.
FRK: Recht auf Vollausbau ist ein Markteingriff
Hinzu kommt die regulatorische Unsicherheit. Zwar plant der Gesetzgeber ein Glasfaserbereitstellungsentgelt, doch ob dieses ausreicht, um die Wohnungswirtschaft zu motivieren, bleibt fraglich. Auch der rechtliche Rahmen rund um Open Access, standardisierte Verträge und Investitionsschutz ist komplex und in Bewegung. Viele Eigentümer schrecken vor dieser Unsicherheit zurück. Auch der FRK sieht die Pläne der Bundesregierung skeptisch. Ein Glasfaserbereitstellungs- sowie die geplanten fixen Zugangs- und Mitnutzungsentgelte blockieren aus Sicht des Verbandes die Marktdynamik und den Wettbewerb um die beste Lösung für den FTTH-Ausbau. „Das Recht auf Vollausbau, welches dann greift, wenn nur eine einzige Wohnung in einem Gebäude einen Glasfaseranschluss erhält, stellt einen Markteingriff dar, der grundlegende Rechte der Gebäudeeigentümer verletzt und hohe Investitionsrisiken für den Aufbau gebäudeinterner Netze mit sich bringt“, erklärt der FRK. „Einen derartigen Eingriff in den Markt lehnen wir ab“, erklärt FRK-Vorsitzender Ralf Berger.
Wirtschaftsprüfer Bremer beobachtet außerdem eine gewisse Trägheit aufseiten großer Netzbetreiber: „Die Zeit, in der das Nebenkostenprivileg auslief, war lang genug. Doch viele Kabelnetzbetreiber haben wenig unternommen, um sich strategisch neu aufzustellen.“ Das zeigt aus seiner Sicht: Selbst Akteure mit viel Marktmacht setzen derzeit kaum Impulse. Damit spielt er unter anderem auf Vodafone an. Allerdings ist Vodafone über das Joint-Venture OXG intensiv mit dem Ausbau von Glasfaserleitungen beschäftigt. Bis zu sieben Millionen Haushalte will das Unternehmen versorgen. Die ersten Leitungen können bereits gebucht werden.
Mieter von Glasfaser-Zukunft ausgeschlossen?
Für Mieter bedeutet das: Sie sind von der Glasfaserzukunft oft ausgeschlossen, obwohl vor dem Haus schon alles liegt. Gerade in einem Markt, in dem Wohnungen knapp sind, bleibt ihnen meist keine Wahl, als sich mit dem Vorhandenen zu arrangieren.
Zugleich könnten neue Nutzungsarten den Druck erhöhen. Intelligente Stromzähler, dynamische Tarife oder die Steuerung von Balkonkraftwerken erfordern stabile Datenverbindungen. Hier sieht Bremer Potenzial: „Wer Glasfaser im Haus hat, kann perspektivisch auch neue digitale Produkte anbieten, die über Internet laufen. Wohnungswirtschaft und Energiebranche müssen enger zusammenrücken.“ Er rät den Glasfaseranbietern, sich beispielsweise beim Thema Smart Meter zu positionieren. „Sie sind bereits im Keller. Die Stromzähler oftmals auch.“ So sei man ein interessanter Gesprächspartner für Energienetzbetreiber und Wohnungswirtschaft.
Ob das reicht, die Blockade in der Netzebene 4 zu lösen, bleibt abzuwarten. Bremer ist skeptisch: „Wenn der Markt es nicht regelt, wird die Regulierung kommen.“ Ob diese dann ausgewogen oder überzogen ist, sei jedoch offen. Erste Ideen hat das neue Bundesdigitalministerium bereits vor einigen Wochen öffentlich gemacht.